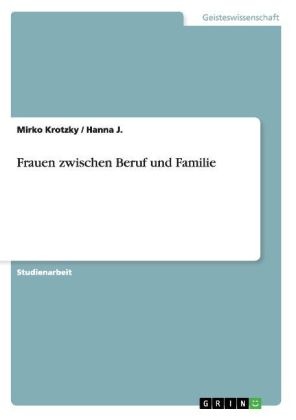En savoir plus
Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Soziologie - Familie, Frauen, Männer, Sexualität, Geschlechter, Note: 2,0, Georg-August-Universität Göttingen (Sozialwissenschaftliche Fakultät - Institut für Soziologie), Veranstaltung: Geschlecht und soziale Ungleichheit, 23 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Neben diversen Statistiken hat uns vor allem die Erfahrung gezeigt, dass die häuslichen und familiären Pflichten sowie Betreuungs- und Reproduktionsaufgaben nach wie vor überwiegend von Frauen wahrgenommen werden. Dies wirkt sich nicht nur auf ihre Arbeitsregelungen aus, sondern schränkt außerdem ihre Chancen auf einen Arbeitsplatz ein, der den durchschnittlichen Arbeitsplätzen für Männer vergleichbar ist.
Die Beschäftigungsverhältnisse von Frauen sind durch Unterbrechungen gekennzeichnet. Sie arbeiten daher überdurchschnittlich oft in Teilzeitjobs und atypischen Beschäftigungsverhältnissen. Diese Faktoren wirken sich negativ auf die Laufbahn, das Entgelt und die Rente aus und können auch dazu führen, dass Frauen weniger geneigt sind, einer Beschäftigung nachzugehen. Nach wie vor besteht diese traditionelle Aufteilung von Betreuungspflichten und Berufstätigkeit zwischen Mann und Frau. Woran liegt es also, dass es bis heute Männern und Frauen nicht möglich ist, ein angemessenes Gleichgewicht zwischen ihrer Familie und ihrem Beruf zu finden?
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich insbesondere mit eben dieser Frage und infolgedessen mit der Vorstellung grundlegender und einschneidender Theorien in der feministischen Sozialforschung. Zum Zwecke der praktischen Anwendung nutzen wir in diesem Zusammenhang verschiedene empirische Daten, die vom Statistischen Bundesamt der Bundesrepublik Deutschland zur Verfügung gestellt wurden und beziehen sie jeweils auf die vorgestellten sozialwissenschaftlichen Theorien.