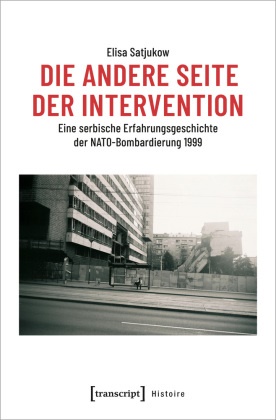En savoir plus
20 Jahre nach den NATO-Luftangriffen auf Serbien im Rahmen des Kosovokrieges eröffnet Elisa Satjukow den Blick auf die »andere Seite« dieser Intervention. Anhand bisher unerschlossener Dokumente fragt sie nach den Erfahrungen, Emotionen und Erinnerungen der serbischen Gesellschaft unter den Bedingungen von Bomben und Ausnahmezustand im Frühjahr 1999. Dabei zeigt sie, dass die NATO-Intervention nicht nur eine Schlüsselerfahrung der Milosevic-Ära darstellt: Bis heute bildet der völkerrechtswidrige Einsatz einen umkämpften Erinnerungsort für Serbien, das zwischen Russland und Europa, zwischen Opfertum und Heroismus, zwischen Nationalismus und Demokratie seinen Weg sucht.
A propos de l'auteur
Elisa Satjukow, geb. 1986, ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Historischen Seminar der Universität Leipzig. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in der Ost- und Südosteuropäischen Geschichte, Oral History sowie Emotions-, Geschlechter- und Erinnerungsforschung.
Résumé
20 Jahre nach den NATO-Luftangriffen auf Serbien im Rahmen des Kosovokrieges eröffnet Elisa Satjukow den Blick auf die »andere Seite« dieser Intervention. Anhand bisher unerschlossener Dokumente fragt sie nach den Erfahrungen, Emotionen und Erinnerungen der serbischen Gesellschaft unter den Bedingungen von Bomben und Ausnahmezustand im Frühjahr 1999. Dabei zeigt sie, dass die NATO-Intervention nicht nur eine Schlüsselerfahrung der Miloševic-Ära darstellt: Bis heute bildet der völkerrechtswidrige Einsatz einen umkämpften Erinnerungsort für Serbien, das zwischen Russland und Europa, zwischen Opfertum und Heroismus, zwischen Nationalismus und Demokratie seinen Weg sucht.
Texte suppl.
»The account diversifies our understanding of the NATO bombings and crucially our understanding of what it meant to people beyond the nationalist stereotypes often reiterated in the media.«
Commentaire
»The account diversifies our understanding of the NATO bombings and crucially our understanding of what it meant to people beyond the nationalist stereotypes often reiterated in the media.«
Geert Luteijn, Comparative Southeast European Studies, 69/4_(2021) 20220113