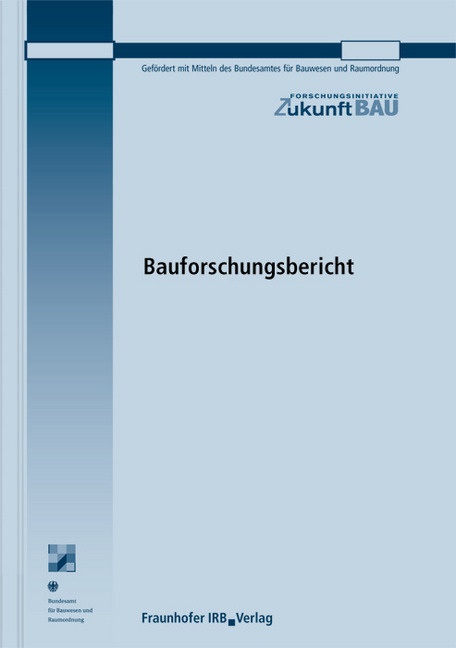Mehr lesen
Schwerpunkt der Arbeit ist die Bearbeitung der Feuchteproblematik an den Balkenköpfen innengedämmter Fassaden. Neben dem Aufzeigen hygrothermischer Wirkungen sollen die Effekte quantifiziert und Lösungen unter Einbeziehung der Heizungstechnik für eine schadensfreie Ausführung aufgezeigt werden. Das Thema wird sowohl messtechnisch direkt vor Ort im Nutzungszustand an einem Reihenhaus in Senftenberg/NL als auch experimentell an einem errichteten Messstand im Labor, jeweils gestützt durch eine moderne Rechentechnik für den gekoppelten Wärme-Feuchtetransport, bearbeitet. Die Idee von luftdicht in den Balkenkopf eingebrachten, passiven oder aktiven Wärmestäben zur Wärmezufuhr genauso wie die heizrohrgestützte, über Vor- und Rücklaufleitung eingebrachte Wärmemenge zur Vermeidung unzulässiger hygrischer Zustände erfahren eine Quantifizierung.
Inhaltsverzeichnis
1 Einführung 7
1.1 Ausgangssituation und Zielstellung 7
1.2 Beschreibung von hygrothermischen Schadensfeldern im Holzbalkenkopfbereich 9
1.3 Empfehlungen der Literatur zur Vermeidung von Schäden nach 1.2 14
1.4 Eigene Vorschläge bzgl. 1.3 16
2 Testhaus in Senftenberg 18
2.1 Objektbeschreibung 18
2.1.1 Allgemeines 18
2.1.2 Angaben zur Konstruktion 19
2.1.2.1 Wände
2.1.2.2 Dach
2.1.2.3 Decken
2.2 Sanierung 20
2.2.1 Allgemeines 20
2.2.2 Innendämmung der Außenwände 21
2.2.2.1 Styropor-Gipskarton-Verbundplatte
2.2.2.2 Hebel Multipor
2.2.2.3 Homatherm Celluloseplatte
2.2.2.4 Calsitherm Calciumsilikat
2.2.3 Balkenkopfbereich 23
2.3 Dokumentation 25
3 Präparation des Objektes und Applikation der Messfühler im Testhaus Senftenberg 46
3.1 Messwerterfassung 46
3.1.1 Messstellen-Übersicht 46
3.1.2 Wetterstation und Klimamessung 56
3.1.3 Wandaufbau und Messstellenanordnung 56
3.1.3.1 Styropor-Gipskarton-Verbundplatte
3.1.3.2 Hebel Multiporplatte
3.1.3.3 Homatherm Celluloseplatte
3.1.3.4 Calsitherm Calciumsilikatplatte
3.1.3.5 Hufgard Klimaputz
3.1.4 Anordnung der Messstellen am Kopf des Holzbalkens 58
3.1.5 Kurzbeschreibung der Sensoren und Messgeräte 60
3.1.5.1 Temperaturfühler
3.1.5.2 Wärmestrommessplatten
3.1.5.3 Pyranometer
3.1.5.4 Luftfeuchtefühler
3.1.5.5 Sensorik für die Messung der Luftbewegung im Luftspalt am Balkenkopf
3.1.5.6 Holzfeuchtemessfühler
3.2 Datenerfassung und -verarbeitung 65
3.3 Dokumentation zur Messtechnik 65
4 Numerische Simulation 87
4.1 Ungestörte Wandfelder - Überprüfen der Software 88
4.2 Balkenkopfbereich 96
4.2.1 Außenklimatische Randbedingungen: Testreferenzjahr TRY Essen 96
4.2.2 Klimatische Randbedingungen: Testhaus Senftenberg 104
4.3 Wärmestab 111
4.3.1 Darstellungen des Sachverhaltes 111
4.3.2 Variantenvergleich 116
5 Messungen 135
5.1 Klimatische Randbedingungen 135
5.2 Messungen im ungestörten Wandfeld 140
5.3 Messungen im Balkenkopfbereich 141
5.3.1 Messungen der hygrothermischen Zustände 141
5.3.2 Messungen der Holzfeuchte der Balkenköpfe 166
5.3.3 Durchgriff des Raumluftzustandes 180
5.3.3.1 Natürliche Lüftung
5.3.3.2 Erzwungene Lüftung
5.4 Thermografie 200
6 Labormessstand 203
6.1 Einführung 203
6.2 Aufgabenstellung 203
6.3 Bautechnische Umsetzung 207
6.3.1 Allgemeines 207
6.3.2 Aufbau des Versuchsstandes 208
6.4 Numerische Strömungssimulation 214
6.5 Laborative Messungen 221
6.5.1 Klimatische Randbedingungen am Balkenkopf -Prüfstand 221
6.5.2 Prüfstand - Balkenkopfbereich 225
6.5.2.1 Hygrothermische Zustände
6.5.2.2 Holzfeuchten
6.5.2.3 Lokaler Wärmeenergieeintrag
7 Auswertung 238
7.1 Auswertung der Berechnungen 238
7.1.1 Balkenkopfbereich unter Nutzungsbedingungen 238
7.1.1.1 Wirkung von Heizrohrführungen
7.1.1.2 Studie zum Einfluss eines passiven oder aktiven Wärmestabes
7.1.2 Balkenkopfprüfstand 240
7.2 Auswertung der Messergebnisse 240
7.2.1 Testhaus Senftenberg 240
7.2.2 Laborative Messungen 246
8 Aussagen und Ausblick 249
9 Literatur 254
10 Anhang 255
10.1 Patentantrag 255
10.2 Aktivitäten für die Umsetzung der Ergebnisse 255
10.3 Kurzbericht 256