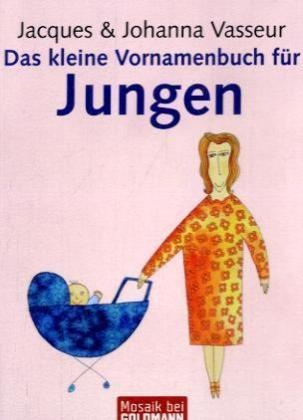Ulteriori informazioni
Der kompetente kleine Auswahlhelfer
Seinen Namen trägt man ein Leben lang. Darum gilt, was Platon schon wusste: "Die Namenserteilung ist kein gleichgültiges Anliegen und sollte nicht vom Zufall abhängen." Also: Zum "Kleinen Vornamenbuch" greifen und sich helfen lassen! "Die Namenserteilung ist kein gleichgültiges Anliegen und sollte nicht vom Zufall abhängen." (Plato)
Info autore
Johanna und Jacques Vasseur gelangten über das Studium antiker und moderner Sprachen zur vergleichenden Sprachwissenschaft. Schon seit Jahren gilt ihr besonderes Interesse der Vornamensforschung. In einem umfangreichen Privatarchiv sammelten sie Material und Literatur über Vornamen aus aller Welt.
Johanna und Jacques Vasseur gelangten über das Studium antiker und moderner Sprachen zur vergleichenden Sprachwissenschaft. Schon seit Jahren gilt ihr besonderes Interesse der Vornamensforschung. In einem umfangreichen Privatarchiv sammelten sie Material und Literatur über Vornamen aus aller Welt.
EXCERPT: Die Namenserteilung ist kein gleichgültiges Anliegen und sollte nicht vom Zufall abhängen.
Plato (5./4. Jh. v. Chr.)
Der wichtigste Bestandteil unseres Wortschatzes dürfte wohl unser eigener Rufname sein, denn er verbindet uns mit unserer Umgebung, unseren Quellen, unserer Familie, unserer Kindheit. Er ist oft das einzige Zeichen, das wir im Gedächtnis anderer hinterlassen. Wir reden nur von Vornamen, denn die Familiennamen sind eine verhältnismäßig junge Erscheinung (11. Jh. in Südfrankreich, Ende des 12. Jh. in Paris, 13. Jh. in Deutschland). Vorher und mit Ausnahme der römischen Welt hatte jeder Mensch nur einen, von den Eltern frei gewählten Rufnamen.
Viele Eltern legen Wert auf die Unverwechselbarkeit des Vornamens ihres Kindes, und sie haben recht. Vor Kurzem hat ein Gericht allerdings festgestellt, dass 13 Vornamen für ein Kind zu viel wären. Vier werden für angemessen gehalten. Dagegen werden Familiennamen wie Schmidt, Müller, Meyer, Schulze usw. in Deutschland, Janssens, Desmet, Declercq, Devos usw. in Belgien und den Niederlanden oder Lefebvre, Martin/Marty, Dupont in Frankreich - demografisch bedingt - immer häufiger. Die Schweden haben vorgesorgt: In diesem Land, wo zehn Prozent der Bevölkerung schon Johansson, Andersson, Nilsson oder Eriksson heißen, kann man - gegen eine Kleinigkeit für die Staatskasse - einen anderen "neuen" Familiennamen erhalten, der jedoch nicht an eine andere Familie vergeben werden darf.
Die Mehrheit unserer Vornamen geht auf eine Zeit zurück, in der nur sehr wenige Auserwählte schreiben und lesen konnten und in der die Lebenserwartung kaum länger als dreißig Jahre währte. Unter solchen Umständen war der Rufname oft das einzige Kennzeichen, das Eltern ihren Kindern geben konnten, daher seine Wichtigkeit. Denn unsere Vornamen sind kein Buchstabenbündel, rein zufällig zusammengesetzt, sondern haben alle einen tieferen Sinn. Der Zweck dieses Buches ist, die Herkunft jedes Vornamens zu erhellen, die Zusammensetzung und Bedeutung zu erklären.
Seit grauester Vorzeit sind auf dem Gebiet der Namengebung die elterlichen Sorgen und Beweggründe auffallend ähnlich. Tausend Jahre vor unserer Zeitrechnung nannten Inder ihre Kinder "Jivanaräma" (m = allen Menschen gefallend), oder "Purushottama" (m = der Vorzüglichste der Menschen). Die Gallier "Coveros" (m = der Gerechte), "Caratios" (m = der Geliebte) oder "Dagovassus" (m = treuer Diener). Die Hebräer "Mehuman" (m = der Treue), "Jescher" (m = der Rechtschaffene), "Barsiläi" (m = der Eisenharte). Die Ägypter "Tenofre" (w = die Gute), "Tema'i" (w = die Liebenswürdige). Die Etrusker "Herme" (m = der Starke). Die Indianer von Nordamerika "Kah-Gui-Gue-Gah-Bowh" (m = immer treu). Die Germanen "Friunt" (m = Freund), "Willicomo" (m) oder "Chraft" (m). Araber von Nordafrika "el-Bäri" (m = der Vortreffliche). Tataren "Dewletuqua" (m = Reichtumssohn).
Die heutigen Namen "Bernd" (= Bernhard) oder "Eberhard" entsprechen dem altindischen: "Caktisinha" (m = mächtiger Löwe), dem indianischen (Ontario) "Keeocukc" (m = der wachsame Fuchs), dem indianischen (Peru) "Hatun Huamang" (m = der große Geier), dem altägyptischen "Moui" (m = Löwe), dem keltischen "Arthur" (m = der Bär) oder dem gallischen "Tarvillos" (= Stier).
"Michael", "Christina" und "Markus" sind enge Sinnverwandte des altindischen "Civadatta" (m = vom Gotte Siwa geschenkt), der altägyptischen "Thoütmosis" (m = Sohn von (Gott) Thoth), "Thäisis" (w = die der Isis) oder wie "Tut-ench-Amon" (m = lebendes Bild von (Gott) Am(m)on) verwandt ist mit dem gallischen "Esugenus" (m = Sohn des (Gottes) Esus), oder dem karthagischen: "Hamilkar" (m = Diener (des Gottes) Melkart).
Manchmal ist uns die Bedeutung der Vornamen noch klar: "Amadeus", "Modest", "Christian", "Franz" brauchen keine lange Erklärung. Bei anderen muss man schon etwas mehr nachforschen: "Nadine", "Renate", "Sabine", "Dominique". Bei einigen, z. B. "Vanessa", "Anton", "Emil", ist es noch viel schwieriger, und für einige wenige Namen bleibt der Ursprung umstritten, wenn nicht gar völlig unbekannt.
Um die zahlreichen Schwierigkeiten und Irrtümer zu vermeiden, welche den Weg des Forschers pflastern, muss er viele Sprachen gründlich kennen. Wer nur einer Sprache mächtig ist, wird instinktiv verleitet, alles auf diese zurückzuführen. Die phonetischen und semantischen Gesetze jeder Sprache verdienen eine besondere Aufmerksamkeit, denn Personennamen sind Wörter, die denselben Gesetzen unterworfen sind wie alle übrigen Elemente einer Sprache.
Aber dies reicht bei Weitem nicht aus: Der Weg bis zur richtigen Quelle ist schwierig und oft labyrinthisch verschlungen. Dabei muss man viele Sagen, Gerüchte, optische Täuschungen überwinden. Sehr viele Personennamen wurden vom Wirken der Analogie derart umgestaltet, dass es oft schwer ist, sich zurechtzufinden. Die Volksetymologie (selbst in der Bibel) hat auf dem Gebiet der Personennamendeutung manchen bösen Streich gespielt. Viele Fachleute gingen ihr auf den Leim, umso leichter, da man seit Generationen Legenden verbreitet, die besonders verlockend und schmeichelhaft für die Träger des jeweiligen Namens sind.
Selbst tief greifende Kenntnisse der Psychologie eines Volkes gestatten nicht immer, den Sinn eines Namens zu deuten. Oft hat man, um das Andenken des Vaters, der Mutter oder beider Familien zu verewigen, Elemente der Namengebung zusammengekoppelt, selbst wenn sie logisch nicht zusammenpassten. Es wäre in diesem Falle aussichtslos, in solchen bunten Zusammensetzungen um jeden Preis einen Sinn zu suchen, wenn sie vom Ursprung her keinen gehabt haben.
Für die verbreitetsten Vornamen haben wir den "Zahlwert", das entsprechende Tierkreiszeichen und die damit verbundenen Pflanzen, Blumen und Steine angegeben - nach den Grundsätzen der Kabbalisten (Addieren des Zahlwertes der einzelnen Buchstaben oder Bestandteile nach dem hebräischen bzw. griechischen Alphabet). Hierbei stellt sich die immer gleiche Frage: "Est nomen omen?" Balzac (19. Jh.), der nicht ohne Grund "der Gigant der französischen Literatur" genannt wird, schrieb hierüber: "Die Namen werden im Himmel gegeben. Man wird dort oben benannt, bevor man hienieden lebt. Übrigens bin ich nicht der Einzige, der felsenfest davon überzeugt ist, dass zwischen Namen und Persönlichkeit tief geheime Beziehungen walten ..."
Dieses Werk will nur ein Ratgeber, ein Wegweiser sein. Die Eltern sollten daran denken, dass der von ihnen gewählte Vorname ihr Kind das ganze Leben lang begleiten wird.
Der griechische Philosoph Pythagoras (6. Jh. v. Chr.) riet: "Familienvater, lege deinem Kind einen Namen zu, der ihn in seinen eigenen Augen ehrt!" Ein unsinniger Vorname kann einem Menschen sein ganzes Leben lang Ärger bereiten: in der
Heimat und in der Fremde. In der spanisch sprechenden Welt darf man einen Sohn "Jesus", in Griechenland "Christos" nennen. In England trifft man ab und zu den Mädchennamen "Perdita" (Gestalt aus Shakespeares "Wintermärchen"), der auf Lateinisch "die Verlorene" bedeutet. Das Standesamt ist oft die letzte Schranke gegen die wildeste Fantasie. "Grammophon" (m) und "Fiat" (w) wurden in Deutschland als Vornamen abgelehnt, dagegen in Brasilien "Chevrolet-Ford" (m) und "Herzinfarkt" (m) angenommen. In der Türkei registrierte man mehrere "Ayatollah Khomeini" (m). In Frankreich wurden "Sputnik" und "Guevara" abgelehnt, jedoch "Marx" und "Medor" (m = der traditionelle Name des treuen Hundes) aufgenommen. Der Gipfel der "Subtilität" wurde wohl während der großen Revolution erreicht mit Vornamen wie "Mist" (m), "Maulesel" (m), "Seidenwurm" (m), "Ziege" (w), "Tomate" (w), "Kartoffel" (w, Namenstag: 11. Weinmonat), "Clarinette" (w) und "Café-billard" (m).
Die hebräische Sprache spiegelt die geistige Natur des Universums wider. Die Buchstaben, aus denen sie zusammengesetzt ist, sind Substanz und Element jener Sprache. Die Kenntnis ihrer inneren Gesetze gestattet einen Zugang zur Kenntnis des Göttlichen, von welchem sie herrühren.
Das hebräische Alphabet setzt sich aus 22 Buchstaben zusammen; doch sind die Buchstaben nicht etwa in einer zufälligen Reihenfolge angeordnet, sondern jeder von ihnen entspricht je nach seinem Rang einer Zahl, je nach seiner Form einer Hieroglyphe (griech. Wort = Geheimschrift) und je nach seinen Beziehungen zu den anderen Buchstaben einem Sinnbild.
Die Zahlen bilden drei Klassen, und jede Klasse wird mit neun entsprechenden Buchstaben bezeichnet.
Die erste Klasse enthält die neun einfachen Zahlen, später "arabische Zahlen" genannt, von 1 bis 9 (kleine Zahlen).
Die zweite Klasse, die mit 10 beginnt und mit 90 (neunzig) endet, bilden die mittleren Zahlen.
Die dritte Klasse (große Zahlen) wird aus Produkten von Einern und Zehnern gebildet.
In den Personennamen ersetzt man die Buchstaben durch Zahlen und nimmt mit den Zahlen verschiedene Rechenoperationen vor (vor allem: Addieren).
Jene kabbalistische (das Wort "Kabbala" heißt: Tradition) Methode wird "Gematria" genannt. Sie beruht auf der Einstellung der Zahlen in die erwähnten drei Klassen (s. oben).
Praktische Beispiele:
ADAM schreibt sich (in umgekehrter Ordnung - vom Ende beginnend!):
M.DA = mem daleth aleph = 40 4 1 = 45
DAVID schreibt sich:
DIV.D = daleth vau jod daleth = 4 6 10 4 = 24
REBEKKA:
K.BER = 200 2 100 5 = 307
Der Ursprung der Kabbala liegt in der Zeit des Moses selbst. Siehe die Bibel 1. Mose 14,14: "Abraham bewaffnete 318 seiner ta