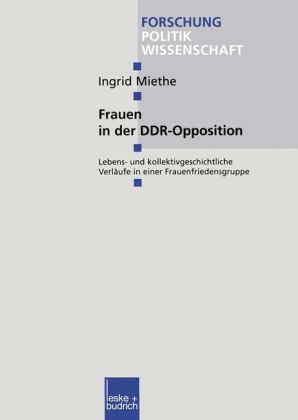Ulteriori informazioni
Opposition und Widerstand in der DDR sind Themen, die bis heute nicht nur im wissenschaftlichen, sondern auch im politischen Diskurs heftig umstritten sind. Da dieser Themenbereich wie kaum ein anderer politisch hoch sensibel und leicht instrumentalisierbar ist, ist es mir wichtig, in der Einleitung ein paar Worte mehr als sonst in wissenschaftlichen Untersuchungen üblich dar über zu verlieren. Als ich mit dieser Untersuchung begann, haben mich die Frauen interes siert, die in der DDR-Opposition politisch aktiv waren und den Herbst '89 wesentlich mit initiiert haben. Die Frage, die mich beschäftigte, war die da nach, was Frauen dazu bringt, ihre Stimme im Gegensatz zu einer schweigen den Bevölkerungsmehrheit zu erheben und Protest und Widerspruch zu arti kulieren. Ich war zunächst auf der Suche nach meinen "Heldinnen", nach Frauen, die ich selbst bewunderte und verehrte. Während der Studie wurde mir von den Frauen sehr viel an Unterstützung und Offenheit entgegenge bracht. Gleichzeitig wurden meine "Heldinnen" dabei zu konkreten Men schen, mit ihren Stärken und Begrenzungen. Hatte ich anfangs nur ihren Mut bewundert, wurde mir während der Untersuchung auch deutlich, wie verzwei felt die Frauen manchmal waren und welch hohen persönlichen Preis sie für ihre Überzeugungen gezahlt haben. In dieser Arbeit wird von Mut und Wi derstand, von Angst und Verzweiflung, von Möglichkeiten und Grenzen die Rede sein. Indem meine "Heldinnen" zu Menschen wurden, wurde widerstän diges Verhalten gleichzeitig menschlicher, alltäglicher und die Frage, warum nicht mehr Menschen den Mut zum Widerspruch gefunden haben, stand mehr als zuvor im Raum.
Sommario
1. Bisherige Forschungsperspektiven.- 1.1 Forschung über Opposition und Bürgerbewegungen der DDR.- 1.2 DDR-Opposition in geschlechtsspezifischer Perspektive.- 1.3 Bewegungsforschung und politischer Akteur.- 2. Das Forschungsdesign.- 2.1 Methodologische Anlage der Untersuchung.- 2.2 Die Etappen des Forschungsprozesses.- 3. Kontextbeschreibung und kollektive Handlungsrahmen.- 3.1 Die unabhängige Friedensbewegung der DDR.- 3.2 Kollektive Handlungsrahmen: Auswertung der Gruppendiskussion.- 3.3 Der Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit in der DDR.- 3.4 Fazit: In Frage stellen, um zu reproduzieren.- 4. Die Rekonstruktion von Lebensgeschichten in Einzelfallanalysen.- 4.1 Elke Buchenwald.- 4.2 Helga Schlesinger.- 4.3 Sophie Leon.- 5. Kontrastiver Vergleich und theoretische Verallgemeinerungen.- 5.1 Typologie.- 5.2 Grenzen und Spielräume des kollektiven Handlungsrahmens.- 5.3 Veränderung typologischer Unterschiede.- 5.4 Zusammenfassung.- Abkürzungen.- Transkriptionszeichen.- Übersichtstabellen.- Bibliographie.
Info autore
Dr. phil. Ingrid Miethe, ist Professorin für Allgemeine Pädagogik an der Evangelischen Fachhochschule in Darmstadt. Derzeit tätigt sie ein Habilprojekt zu biografischen Verläufen von AbsolventInnen der Arbeiter- und Bauernfakultät Greifswald (1946-61).
Riassunto
Das Buch untersucht anhand von Interviews und Gruppendiskussionen Beginn, Verlauf und Ende einer sozialen Bewegung. Am Beispiel einer Frauenfriedensgruppe der DDR geht das Buch der Frage nach, wie es überhaupt dazu kommt, daß Frauen sich in einer Gruppe zusammenschließen, gemeinsam politisch handeln und sogenannte soziale Bewegungen konstituieren und in anderen Situationen wieder individuelle Wege einschlagen, sich politisch zurückziehen oder nur noch punktuell zusammenfinden. Empirische Basis sind eine Gruppendiskussion sowie lebens-und familiengeschichtliche Interviews, die als hermeneutische Fallrekonstruktionen ausgewertet wurden. Bei der Untersuchung werden Parallelen zur westdeutschen 68er Generation deutlich: Es handelt sich um dieselbe Geburtskohorte, und die politische Aktivität stellt die Bearbeitung eines Generationenkonfliktes zwischen den Frauen und der in den Nationalsozialismus involvierten Elterngeneration dar. Deutlich wird auch die große Bedeutung familialer Gewalt für den Zusammenschluß in einer Frauenfriedensgruppe.