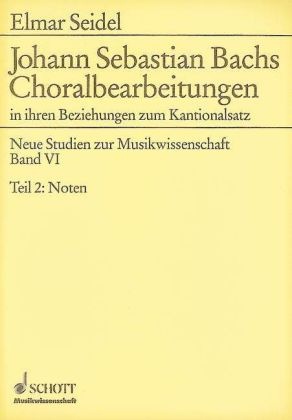Read more
Fragt man nach den Beziehungen Bachscher Choralbearbeitungen zum Kantionalsatz, stellt sich die Frage nach den Tonarten der Choralmelodien. Das eingehende Studium der Geschichte der Tonarten zeigt, daß sowohl deren Lehre als auch der Gebrauch, den die Komponisten von den Tonarten machten, einem steten Wandel unterlag. Anhand von Analysen ausgewählter Liedmelodien verdeutlicht der Autor, welche Satztraditionen vom Beginn des 16. Jahrhunderts bis zu Bachs Lebzeiten lebendig blieben und in welcher Weise Bach diese Traditionen aufnimmt und verwandelt. Die Beschäftigung mit der Satzlehre und Theorie jener Epoche erweist sich auch deshalb als fruchtbar, weil dem heutigen Musiker der Blick auf die historischen Bedingtheiten der Werke Bachs oftmals durch sein Wissen um die spätere Musikentwicklung seit der Wiener Klassik verdeckt wird.
List of contents
Teil 1: Ziel der Arbeit und Erörterung der angewandten Methode - "Schlichte" Choralsätze Bachs - Orgelbüchlein und Kantionalsatz - Erste und zweite Form größerer Choralbearbeitungen Bachs - Literaturverzeichnis - Personenverzeichnis - Sachwörterverzeichnis
Summary
Fragt man nach den Beziehungen Bachscher Choralbearbeitungen zum Kantionalsatz, stellt sich die Frage nach den Tonarten der Choralmelodien. Das eingehende Studium der Geschichte der Tonarten zeigt, dass sowohl deren Lehre als auch der Gebrauch, den die Komponisten von den Tonarten machten, einem steten Wandel unterlag. Anhand von Analysen ausgewählter Liedmelodien verdeutlicht der Autor, welche Satztraditionen vom Beginn des 16. Jahrhunderts bis zu Bachs Lebzeiten lebendig blieben und in welcher Weise Bach diese Traditionen aufnimmt und verwandelt. Die Beschäftigung mit der Satzlehre und Theorie jener Epoche erweist sich auch deshalb als fruchtbar, weil dem heutigen Musiker der Blick auf die historischen Bedingtheiten der Werke Bachs oftmals durch sein Wissen um die spätere Musikentwicklung seit der Wiener Klassik verdeckt wird.