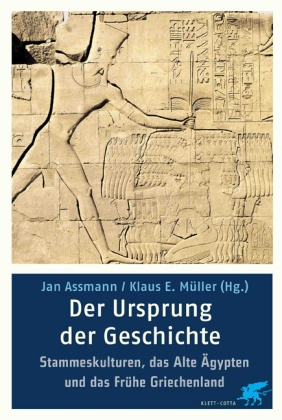Read more
Wie und wo begann das westliche Geschichtsbewußsein?
Auf der Basis neuester anthropologischer und archäologischer Erkenntnisse untersuchen Cornelius Holtorf und Klaus E. Müller Zeitvorstellungen prähistorischer Kulturen und vorschriftlicher Gesellschaften.
Das Verhältnis von Zeit und Staat, Kult und Kalender und die Wandlungen des Geschichtsbewußtseins im Alten Ägypten analysiert Jan Assmann.
Am Beispiel des archaischen Griechenland erläutert Egon Flaig, wie sich die Griechen in ihren Mythen und poetischen Texten (Hesiod, Homer) unter Bezug auf vergangene Ereignisse definierten und sie als Argument benutzten.
Ein eindrucksvoller Beitrag zu einem tieferen Verständnis von Geschichtsbewußtsein und -kultur.
List of contents
Einführung: Zeit und Geschichte (von Jan Assmann)
Der Ursprung der Geschichte (von Klaus E. Müller)
- Völker ohne Geschichte
- Die verewigte Gegenwart
- Die Erinnerung kommt
- Das museale Gedächtnis
- Die Inszenierung der Geschichte
Geschichtskultur in ur- und frühgeschichtlichen Kulturen Europas (von Cornelius Holtorf)
- Was heißt Geschichte in ur- und frühgeschichtlichen Perioden?
- Die Bedeutung der Vergangenheit in der Vergangenheit
- Ausblick
Zeitkonstruktion,Vergangenheitsbezug und Geschichtsbewußtsein im alten Ägypten (von Jan Assmann)
- Zeitkonstruktion und Vergangenheitsbezug
- Zeit und Staat
- Wandlungen des ägyptischen Geschichtsbewußtseins
- Geschichte und Antigeschichte
Der mythogene Vergangenheitsbezug bei den Griechen (von Egon Flaig)
- Strukturierung der Vergangenheit in der archaischen Dichtung
- Ruhm und Gedächtnis. Wie Zeitkonstruktion und normative Referenzmuster in der Adelskultur zusammenhingen
- Institutionalisierung der Polis und Verformungen des kollektiven Gedächtnisses
- Wie man mythische Vergangenheit als Argument benutzte
- Syngeneia. Wie man mit Verwandtschaft um Bündner warb
- Ausblick: Die kulturgeschichtliche Chance einer wirkungslosen Historiographie
Anhang
Bildnachweis
Register
About the author
Jan Assmann, geboren 1938, hatte von 1976 bis 2003 den Lehrstuhl für Ägyptologie an der Universität Heidelberg inne und leitet seit 1978 ein Grabungsprojekt in Luxor (Oberägypten). Seit 2005 ist er Honorarprofessor für Allgemeine Kulturwissenschaft und Religionstheorie an der Universität Konstanz, außerdem Ehrendoktor verschiedener Universitäten, darunter der Hebrew University, Jerusalem. 1998 erhielt er den Preis des Historischen Kollegs.
Autor Klaus E. Müller, geb. 1935, ist Professor für Ethnologie an der Universität Frankfurt am Main. Er hat zahlreiche bedeutende Veröffentlichungen, etwa über die Geschichte der Ethnographie, die Ethnologie des Geschlechterkonflikts und über elementare Formen des sozialen Verhaltens, vorgelegt.
Summary
Wie und wo begann das westliche Geschichtsbewußsein?
Auf der Basis neuester anthropologischer und archäologischer Erkenntnisse untersuchen Cornelius Holtorf und Klaus E. Müller Zeitvorstellungen prähistorischer Kulturen und vorschriftlicher Gesellschaften.
Das Verhältnis von Zeit und Staat, Kult und Kalender und die Wandlungen des Geschichtsbewußtseins im Alten Ägypten analysiert Jan Assmann.
Am Beispiel des archaischen Griechenland erläutert Egon Flaig, wie sich die Griechen in ihren Mythen und poetischen Texten (Hesiod, Homer) unter Bezug auf vergangene Ereignisse definierten und sie als Argument benutzten.
Ein eindrucksvoller Beitrag zu einem tieferen Verständnis von Geschichtsbewußtsein und -kultur.
Foreword
Geschichtskultur in vorschriftlicher Zeit