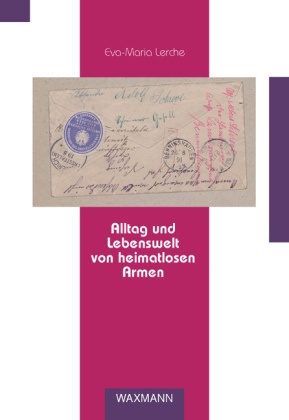Read more
Das Alltagsleben der sozialen Unterschichten im 19. Jahrhundert in Westfalen am Beispiel der sogenannten Landarmen ist Thema dieser Arbeit. Diese rechtlich heimatlosen Bedürftigen wurden auf Grundlage des preußischen Armenpflegegesetzes vom 31. Dezember 1842 von der jeweiligen Provinz als Arme des Landes unterstützt. Ausgangspunkt der mikrogeschichtlichen Studie waren die knapp 1000 erhaltenen Insassenakten des Landarmenhauses der Provinz Westfalen, das von 1844 bis 1891 in Benninghausen bei Lippstadt bestand. Diese Akten enthalten nicht nur behördliche Dokumente, sondern auch eine Vielzahl von biografischen Schriftstücken und Selbstzeugnissen der Landarmen. Durch diese einzigartigen, hier erstmals bearbeiteten Quellen konnte die alltägliche Lebensrealität von Unterschichtenangehörigen, die sonst in der historischen Überlieferung kaum greifbar ist, rekonstruiert und analysiert werden.
Ausgehend vom Konzept eines sozialen Kräftefeldes, das nicht nur Herrschern, sondern auch Beherrschten Handlungs- und Gestaltungsmacht zugesteht, nimmt die Autorin die individuellen ebenso wie die kollektiven Handlungs- und Überlebensstrategien der Landarmen selbst in den Blick. Dies bezieht sich auf das Leben vor bzw. nach der Phase der Bedürftigkeit ebenso wie auf die Zeit, die Landarme in der Anstalt Benninghausen verbrachten. Im Zentrum der Studie stehen die Interaktionen zwischen den Landarmen und den sich formierenden Fürsorgebehörden, dem Anstaltspersonal, den Angehörigen, Freunden und Arbeitgebern sowie den privaten Verpflegern im Umkreis des Landarmenhauses Benninghausen.
About the author
Eva-Maria Lerche, Dr. phil., Jahrgang 1974, Studium der Politikwissenschaft, Volkskunde/Europäischen Ethnologie sowie Neueren und Neuesten Geschichte in Münster, Promotion in Volkskunde 2008, arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Kompetenzzentrum Schreiben der Universität Paderborn. Sie lebt in Münster.
Report
Eva-Maria Lerche hat ihre Arbeit selbst eine Mikrostudie genannt [...] Aber die Arbeit leistet viel mehr als es Mikrostudien gemeinhin tun, weil sie den großen Zusammenhang nicht aus dem Blick verliert und damit den Rahmen liefert, in den ihre Einzelbeobachtung und die individuellen Biografien einzuordnen sind. Die Arbeit liest sich spannend und erschließt in vielen Aspekten neue Perspektiven, die sich ihrem Gespür für Details, für Zusammenhänge und der Fähigkeit, zu Deutungen zu gelangen, verdanken. Alles in allem kann diese Untersuchung als ein überzeugendes Beispiel historischen Arbeitens in der Volkskunde gelesen werden. - Silke Göttsch-Elten in: Rheinisch-westfälische Zeitschrift für Volkskunde, 2010.