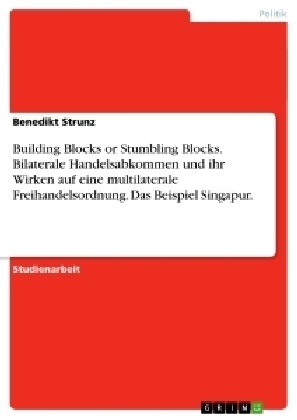Read more
Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Politik - Internationale Politik - Region: Südasien, Note: 1,3, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Seminar für wissenschaftliche Politik ), Veranstaltung: Internationale Wirtschaftsbeziehungen nach Cancún, 32 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Reaktionen vieler Regierungen auf den ins wanken geratenen WTO- Prozess sind geteilt: Während man sich offiziell weiterhin für multilateralen Freihandel engagiert, verhandeln viele Staaten parallel zum WTO- Prozess zunehmend auf bilateraler Ebene. Die Zahl bilateraler Präferenzabkommen hat in der vergangenen Dekade so stark zugenommen, dass in 2005 erstmals mehr als die Hälfte des Internationalen Handels innerhalb der etwa 300 Handelspräferenzabkommen statt fand (Dieter2005:3). Die ökonomischen und politischen Konsequenzen dieser Entwicklung sind stark umstritten. Unter dem Begriff der "Building- Block vs. Stumbling- Block- Debatte" kann eine langwierige Diskussion über die Wirkweise bilateraler Präferenzabkommen verfolgt werden. Während Vertreter der Building- Block- Hypothese den neuen Trend hin zu bilateralem Freihandel als ersten Schritt zu multilateralem Freihandel begrüßen - schließlich könnten sich bilaterale Abkommen sukzessive erweitern - sehen Vertreter der Stumbling- Block- Hypothese in der Zunahme bilateraler Handelverträge eine gefährliche Entwicklung: Bilaterale Handelspräferenzabkommen seien diskriminierend und protektionistisch, führten zu einer Fragementarisierung des Welthandelssystems und untergrüben damit eine multilaterale Freihandelsordnung, argumentieren sie. Die vorliegende Arbeit greift die Diskussion um die Bau- oder Stolperstein- Hypothese auf. Am Beispiel Singapurs - einem der zentralen Akteure in der Proliferation neuer bilateraler Handelsabkommen - wird fallartig geklärt, welche Folgen von bilateralen Handelsabkommen auf eine multilaterale Handelsordnung zu erwarten sind. Ausgehend von einer Einführung in die aktuelle Entwicklung bilateraler Handelspräferenzabkommen (Kap.2), stellt die Arbeit zunächst die aktuelle Diskussion um deren politisches und ökonomisches Wirken auf eine multilaterale Freihandelsordnung vor (Kap.3). Im vierten Kapitel werden die so gewonnenen Argumente am Beispiel Singapur überprüft. Als Fallbeispiel dient das Handelsabkommen` zwischen Singapur und Japan (Japan Singapore Economic Partnership Agreement: JSEPA). Obwohl für eine genaue empirische Untersuchung bislang die notwendigen Daten fehlen, macht die Arbeit deutlich, dass - trotz anders lautender Rhetorik der Regierung - auch die singapurianische Präferenzpolitik eine multilaterale Freihandelsagenda gefährdet. Zum besseren Verständnis des Themas soll zunächst aber in die Theorie des Internationalen Handels eingeführt werden.