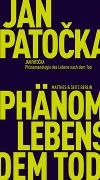Read more
About the author
Jan Patočka, 1907 im österreich-ungarischen Turnov geboren, war ein international hoch geehrter tschechischer Philosoph und Phänomenologe, maßgeblich von Husserl und Heidegger beeinflusst. Seine Hauptwerke umfassen Plato und Europa und Die Bewegung der menschlichen Existenz. Er wurde zum intellektuellen Kopf und ersten Sprecher der Bürgerrechtsbewegung Charta 77, die Menschenrechte einforderte. Patočka starb 1977 in Prag an den Folgen zermürbender Verhöre durch die kommunistische Staatssicherheit und wurde so zu einem Symbol des Widerstands und Märtyrer der Freiheit.
Tobias Keiling, 1983 in Düsseldorf geboren, studierte Philosophie, Soziologie und Rechtswissenschaften in Freiburg, Basel und Paris. Promotion in Philosophie, Forschungsaufenthalte in Boston und Oxford. Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Philosophie der Universität Bonn. Forschungsschwerpunkte Phänomenologie und Philosophische Hermeneutik, Geschichte der Philosophie im 20. Jahrhundert.
Sandra Lehmann arbeitet am Institut für Interkulturelle Religionsphilosophie in Wien und beschäftigt sich vor allem mit der Frage, wie metaphysisches Denken nach dem vielfach verkündeten Ende der Metaphysik weitergeführt werden kann. Sie hat über das Werk Jan Patočkas promoviert, mehrere Studien dazu verfasst und es wiederholt ins Deutsche übersetzt.
Summary
Wie ist unsere Beziehung zu den Toten, und wie beeinflusst der Tod eines geliebten Menschen unser weiteres Leben? Jan Patočka, einer der bedeutendsten Schüler Edmund Husserls und Wegbereiter der tschechischen Phänomenologie, widmet sich in diesem Essay einer der grundlegendsten Fragen der Philosophie: Gibt es ein Leben nach dem Tod? Jenseits religiöser Dogmen und metaphysischer Spekulationen untersucht er die Strukturen des Bewusstseins angesichts der Endlichkeit. Wie erscheint uns der Tod als Phänomen? Welche Bedeutung hat die Antizipation des eigenen Endes für die Konstitution von Lebenswelt und Zeitlichkeit? Mit der ihm eigenen philosophischen Präzision entwickelt der Prager Denker eine Perspektive auf Sterblichkeit und Unsterblichkeit, die weder in der traditionellen Metaphysik noch in der naturwissenschaftlichen Reduktion aufgeht. Seine Prämisse ist, dass unsere Existenz immer durch ein ursprüngliches und wechselseitiges »Sein für andere« stattfindet. Ein philosophisches Vermächtnis des Bürgerrechtlers und Philosophen, der 1977 nach Verhören durch die Staatspolizei starb – sein bewegender Beitrag zur Phänomenologie der menschlichen Existenz, der hier erstmals auf Deutsch vorliegt.