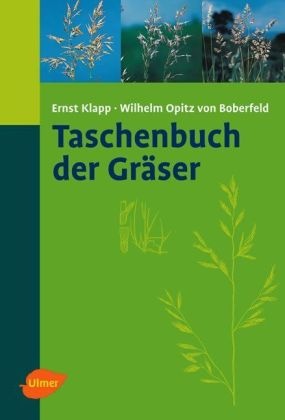Read more
In dieser Süßgräser-Flora sind insgesamt 214 Gräserarten im nichtblühenden und blühenden Zustand beschrieben. Ergänzt werden diese Angaben um die Häufigkeit des Vorkommens und Hinweisen zum Gefährdungsgrad, zu den Umweltansprüchen (Standort und Bewirtschaftung) und den Nutzungsmöglichkeiten als Futterpflanze sowie für Begrünungszwecke. Neben Hinweisen für Saatgutmischungen wird auch auf die Variabilität innerhalb der Arten sowie die sich daraus ergebenden Konsequenzen eingegangen.
List of contents
Vorwort7
1 Süßgräser und Grasartige 8
1.1 Nicht blühender Zustand8
1.2 Blühender Zustand 9
2 Spezielle Merkmale12
2.1 Abkürzungen12
2.2 Nicht blühender Zustand 13
2.3 Blühender Zustand25
3 Bestimmungsschlüssel34
3.1 Einführung34
3.2 Nicht blühender Zustand 34
3.2.1 Gruppenbestimmung 34
3.2.2 Blätter borstenartig 35
3.2.3 Blätter nicht borstenartig 37
3.2.3.1 Jüngstes Blatt gefaltet 37
3.2.3.2 Jüngstes Blatt gerollt42
3.3 Blühender Zustand 54
3.3.1 Gruppenbestimmung54
3.3.2 Ähren55
3.3.3 Scheinähren 57
3.3.4 Fingerähren und (Schein-)Ährentrauben 60
3.3.5 Einfache Trauben 60
3.3.6 Doppeltrauben 62
3.3.7 Rispen64
3.3.7.1 Ungewöhnliche Merkmale 64
3.3.7.2 Einästige Rispen65
3.3.7.3 Zweiästige Rispen 66
3.3.7.4 Drei- bis vielästige Rispen 69
3.4 Gruppenschlüssel 72
3.4.1 Straußgrasgruppe (Agrostis-Apera) 72
3.4.2 Fuchsschwanzarten (Alopecurus spec.) 73
3.4.3 Hafergruppe (Arrhenatherum-Avena-Danthonia-Helictotrichon-Trisetum-Ventenata) 74
3.4.4 Trespenarten (Bromus spec.) 76
3.4.5 Reitgrasgruppe (Calamagrostis-Stipa) 78
3.4.6 Queckenarten (Elymus spec.) 80
3.4.7 Schwingelgruppe (Festuca-Micropyrum-Vulpia) 81
3.4.8 Schwadengruppe (Glyceria-Puccinellia) 83
3.4.9 Gerstenarten (Hordeum spec.)85
3.4.10 Kammschmielenarten (Koeleria spec.) 85
3.4.11 Weidelgras-/Lolcharten (Lolium spec.) 86
3.4.12 Lieschgrasarten (Phleum spec.)87
3.4.13 Rispengrasarten (Poa spec.)88
3.4.14 Borstenhirsearten (Setaria spec.) 90
3.5 Sonderschlüssel91
3.5.1 Schaf-Schwingel (Festuca ovina, Sammelart)91
3.5.2 Rot-Schwingel (Festuca rubra, Sammelart) 94
3.5.3 Federgras (Stipa pennata, Sammelart) 95
3.5.4 Getreide (Hauptarten)97
4 Abbildungen der Arten97
4.1 Ähren, Fingerähren und Scheinähren 97
4.2 Trauben und Rispen 113
4.3 Blütenteile 150
5 Arteigenschaften152
5.1 Beschreibung 152
5.2 Tabellenübersicht152
5.2.1 Blütezeit, Lebensdauer und Wuchsform 211
5.2.2 Gefährdete Gräser 215
5.2.3 Wert- und ökologische Kennzahlen 217
5.2.4 Vergesellschaftung 221
6 Saatgutmischungen 225
6.1 Artenfrage 225
6.1.1 Artenumfang225
6.1.2 Grünland228
6.1.3 Ackerfutter 232
6.1.4 Ackergrünbrachen235
6.1.5 Rasen 236
6.2 Sortenfrage 243
6.2.1 Grundsätzliches 243
6.2.2 Sorteneigenschaften245
6.2.2.1 Futternutzung 245
6.2.2.2 Rasennutzung 248
6.3 Fertigrasen 250
7 Literaturverzeichnis252
8 Artenverzeichnis 254
8.1 Trivialnamen254
8.2 Botanische Bezeichnung 261
About the author
Prof. Dr. Ernst Klapp war Direktor des Instituts für Pflanzenbau, Bonn.
Prof. Dr. Dr. Wilhelm Opitz von Boberfeld ist Professor für Grünlandwirtschaft und Futterbau und war an der Justus-Liebig-Universität Gießen (HE) tätig.
Summary
Der Klassiker unter den Gräserbüchern – jetzt in der 13., vollständig aktualisierten Auflage!
- 214 Süßgrasarten im blühenden und nichtblühenden Zustand
- mit zahlreichen detaillierten Zeichnungen von jeder Art
- Informationen über Vorkommen, Ansprüche und Nutzung
In dieser Süßgräser-Flora sind insgesamt 214 Gräserarten im nichtblühenden und blühenden Zustand beschrieben. Ergänzt werden diese Angaben um die Häufigkeit des Vorkommens und Hinweisen zum Gefährdungsgrad, zu den Umweltansprüchen (Standort und Bewirtschaftung) und den Nutzungsmöglichkeiten als Futterpflanze sowie für Begrünungszwecke. Neben Hinweisen für Saatgutmischungen wird auch auf die Variabilität innerhalb der Arten sowie die sich daraus ergebenden Konsequenzen eingegangen.