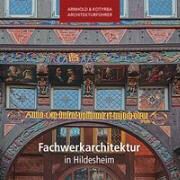Read more
Neben den mittelalterlichen Sakralbauten war das alte Hildesheim von einer geradezu unübersehbaren Fülle an historischen Bürgerhäusern geprägt. Hier überwog die Zahl der Fachwerkbauten bei weitem die der steinernen Wohngebäude. Fachwerk bestimmte bis in das 19. Jahrhundert das alltägliche Baugeschehen in Hildesheim sowie in der gesamten Region. Die hiesige Fachwerkarchitektur gehört in den Bereich des niederdeutschen Fachwerks.
Im aufstrebenden, hochmittelalterlichen Hildesheim (12. und 13. Jahrhundert) entstanden neben bedeutenden Sakralbauten auch anspruchsvolle Wohnhäuser für vermögende Stadtbewohner. Solche Wohnbauten waren bisweilen große Steinhäuser mit repräsentativen Fassaden. Mit dem gegen 1300 errichteten Tempelhaus am Markt ist ein schönes Beispiel erhalten. Eine Variante des mittelalterlichen Wohnbaus waren zweiteilig aufgebaute Bürgerhäuser. Sie umfassten einen in Fachwerk errichteten sowie einen massiv ausgeführten, steinernen Gebäudeteil. Solche Steinwerke oder Kemenaten sind in zahlreichen norddeutschen Städten überliefert. In Hildesheim sind allerdings nur wenige Beispiele dieser Bauform bekannt.
In den Städten zwischen Harz und Weser bildeten sich an den Fachwerkbauten jeweils spezifische Varianten konstruktiver und gestalterischer Art aus. Hier sind die unterschiedlichen Ausprägungen des für den niederdeutschen Fachwerkbau typischen Schnitzwerks besonders bemerkenswert. Jede der größeren Städte brachte ihre Eigenheiten hervor.
Der Begriff Fachwerk beschreibt keinen Stil sondern eine Baukonstruktion. Es handelt sich um eine Holz-Skelettbauweise, wobei die senkrechten und waagerechten Gefügeteile so genannte Gefache umschließen, die mit anderen Baumaterialien, z.B. mit Lehmflechtwerk oder Backsteinen, geschlossen (ausgefacht) werden. Ein Fachwerkgefüge ruht über einem steinernen Fundament, das als Sockel über das Bodenniveau reicht. Auf dem Sockel liegt die Grundschwelle, welche als Auflager für die tragenden Stützen (Ständer) dient. Bis in das 13. Jahrhundert war es üblich, die Stützen wie Pfosten in den Boden einzugraben und hier auf einzelne Fundamentsteine zu stellen. Solche Pfostenbauten waren mit ihren eingegrabenen Stützen nicht sehr dauerhaft.
Die frühesten Fachwerkbauten werden als Ständerbauten bezeichnet, da die tragenden Stützen die wesentlichen Gefügeelemente darstellen. Die Ständer laufen auch bei mehrgeschossigen Häusern von der Grundschwelle bis an den Dachansatz (Traufe) durch. Die Balkenlagen der Geschossdecken sind jeweils in den Ständern ein- bzw. durchgezapft. Solche Ständerbauten, wie sie sich vereinzelt in Quedlinburg (Wordgasse 3 von 1347), Halberstadt und auch Braunschweig erhalten haben, sind in Hildesheim nicht überliefert.
In Hildesheim herrschte seit dem 15. Jahrhundert die traufständige Bauweise vor. Dies bedeutet, dass die Häuser meist mit der Dachseite zur Straße ausgerichtet wurden. Dies ist in historischen Abbildungen und in den erhaltenen Quartieren deutlich zu sehen. In der vorangegangenen Epoche, im 12. und 13. Jahrhundert, waren die meisten Wohngebäude vermutlich giebelständig. Vereinzelt wurden Giebelhäuser auch noch in späteren Zeiten errichtet (Knochenhaueramtshaus). Ein Wechsel in der Ausrichtung der Häuser zur Straße von der Giebel- zur Traufstellung, die so genannte Firstschwenkung, ist für zahlreiche andere Städte ebenfalls zu belegen.
Der reine Ständerbau wurde frühzeitig durch eine Mischbauweise abgelöst, indem man die Obergeschosse an den straßenseitigen Fronten auskragen ließ, während die Rückseiten der Häuser weiterhin mit durchgehenden Ständern errichtet wurden. Somit war eine neue Konstruktionsweise entwickelt: der Stockwerkbau. Bei Stockwerkbauten ist jedes Stockwerk eigenständig abgezimmert, so dass die Ständer entsprechend nur noch über eine Geschosshöhe reichen und in jedem Stockwerk über entsprechenden Schwellen ruhen.
List of contents
Hildesheim - Hochburg des Niedersächsischen Fachwerkbaus
Fachwerkarchitektur in Hildesheim
Brühl 31
Brühl 20 (Hofgebäude)
Andreasplatz, "Umgestülpter Zuckerhut"
Markt 2, ehem. Wollenwebergildehaus
Markt 7, Knochenhaueramtshaus
Am Steine 4-6
Gelber Stern 21, Waffenschmiedehaus
Brühl 30
Hinterer Brühl 15
Marktstraße 21, Storre-/ Wedekindhaus
Hinterer Brühl 12a, Wernersches Haus
Hinterer Brühl 19
Kesslerstraße 52, ehemalige Großvogtei
Markt 4, Stadtschänke
Kesslerstraße 52, Logenhaus
Kesslerstraße 69
Markt 8, Bäckeramtshaus
Übersicht zur Baugestaltung