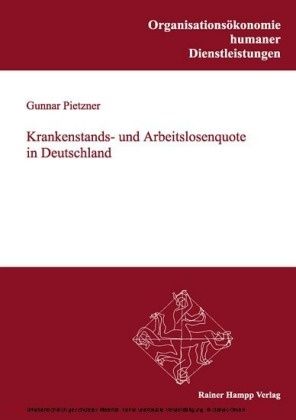Read more
Der nicht nur in Deutschland zu beobachtende inverse Zusammenhang zwischen Krankenstand und Fehlzeitenquote nimmt seit Jahren eine prominente Stellung in der wirtschaftswissenschaftlichen Diskussion ein. Die vorliegende Arbeit versucht dieses Phänomen als Konsequenz individueller Entscheidungen zu erklären. Grundlage für die Erklärung und die folgende empirische Überprüfung bildet die Effizienzlohntheorie. Diese erklärt das Auftreten von arbeitnehmerseitigen Fehlzeiten als Resultat eines Nutzenmaximierungsprozesses. In Zeiten wirtschaftlicher Stagnation bzw. Rezession, die ihren Ausdruck in steigenden Arbeitslosenquoten findet, werden Arbeitnehmer ihren Umfang an Fehlzeiten einschränken, um die für sie negativen Konsequenzen zu reduzieren. Dem gegenüber liefert die Selektionshypothese eine auf Arbeitgeberentscheidung gestützte Deutung für die Höhe des Krankenstandes. Arbeitgeber werden in Phasen des wirtschaftlichen Abschwungs ihre Personalkapazitäten so anzupassen versuchen, dass die weniger produktiven, das heißt häufiger kranken, Arbeitnehmer zuerst entlassen werden. Mit Hilfe der Daten des Sozioökonomischen Panels werden die im Rahmen des theoretischen Teils postulierten Hypothesen einer empirischen Überprüfung unterzogen.
List of contents
1;Geleitwort;6
2;Vorwort;8
3;Inhaltverzeichnis;10
4;Abbildungsverzeichnis;13
5;Tabellenverzeichnis;14
6;Abkürzungsverzeichnis;15
7;1 Einleitung;16
7.1;1.1 Motivation der Arbeit;16
7.2;1.2 Aufbau der Arbeit;19
8;2 Fehlzeiten, Absentismus und Krankenstand;21
8.1;2.1 Kategorisierung von Fehlzeiten;21
8.1.1;2.1.1 Ausfallzeiten;22
8.1.2;2.1.2 Fehlzeiten im engeren Sinne;22
8.1.3;2.1.3 Krankheitsbedingte Fehlzeiten und Absentismus;23
8.2;2.2 Absentismus aus dem Blickwinkel der Principal-Agent-Theorie;24
8.2.1;2.2.1 Die Beziehung Arbeitnehmer - Arbeitgeber;26
8.2.2;2.2.2 Die Beziehung Arzt - Patient;27
8.2.3;2.2.3 Die Beziehung Patient - Arzt;29
8.2.4;2.2.4 Die Beziehung Arbeitgeber - Arzt;30
8.2.5;2.2.5 Fazit;31
8.3;2.3 Fehlzeiteninduzierte Kosten;32
8.3.1;2.3.1 Direkte Kosten;33
8.3.2;2.3.2 Indirekte Kosten;35
8.4;2.4 Entwicklungen des Krankenstandes in Deutschland;37
8.4.1;2.4.1 Krankenstand als gesamtwirtschaftlicher Fehlzeitenindikator;37
8.4.2;2.4.2 Die Entwicklung im Wochenverlauf;38
8.4.3;2.4.3 Langfristiger Verlauf des Krankenstandes;40
8.4.4;2.4.4 Strukturelle Determinanten des langfristigen Krankenstands;42
9;3 Fehlzeiten in der ökonomischen Theorie;50
9.1;3.1 Die Theorie des Arbeitsangebots;51
9.2;3.2 Die Theorie der Arbeitsnachfrage;56
9.3;3.3 Die Effizienzlohntheorie;61
9.3.1;3.3.1 Grundlagen der Effizienzlohntheorie;61
9.3.2;3.3.2 Der Shirking-Ansatz;63
9.3.3;3.3.3 Der Shirking-Ansatz und Arbeitslosigkeit;66
9.4;3.4 Krankenstand im Konjunkturverlauf: Motivation oder Selektion;68
9.5;3.5 Konkurrierende Hypothesen;71
9.6;3.6 Weitere Determinanten individueller Fehlzeiten;73
10;4 Arbeitslosigkeit und Fehlzeiten - empirische Ergebnisse;95
10.1;4.1 Empirische Strategie;95
10.2;4.2 Datenbasis;97
10.3;4.3 Abhängige Variablen und ihre Ausprägung;98
10.4;4.4 Schätzmodelle;99
10.4.1;4.4.1 Probit-Modelle;99
10.4.2;4.4.2 Zähldatenmodelle;100
10.5;4.5 Fehlzeiten und ihre Bestimmungsgründe;104
10.5.1;4.5.1 Variablenspezifikation;104
10.5.2;4.5.2 Sampleselektion;109
10.5.3;4.5.3 Deskriptive Statistik;112
10.5.4;4.5.4 Schätzergebnisse;120
10.6;4.6 Das Risiko der Arbeitslosigkeit;138
10.6.1;4.6.1 Variablenspezifikation;138
10.6.2;4.6.2 Sampleselektion;141
10.6.3;4.6.3 Deskriptive Statistik;142
10.6.4;4.6.4 Schätzergebnisse;144
11;5 Fazit;147
12;Literatur;151
13;Anhang;166
About the author
Gunnar Pietzner wurde 1975 in Greifswald geboren. Er studierte Betriebswirtschaft mit dem Schwerpunkt Personal- und Organisationsökonomik in Greifswald. Seit 2002 ist er an der Universität Witten/Herdecke als Wissenschaftlicher Mitarbeiter beschäftigt. Im